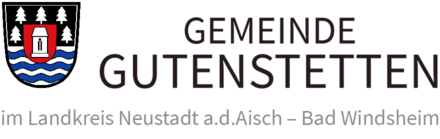Gutenstetten entdecken
Anwesen Kolb, Hauptstraße 12
Bis zum Leerstand nach dem Tod der letzten Eigentümerin Babette Kolb 2006 beherbergte das Anwesen eine kleine Zimmerei mit einer Nebenerwerbslandwirtschaft. Das Gebäude wurde vom Bay. Landesamt für Denkmalpflege als Baudenkmal nachqualifiziert und wird als Bauernhaus bzw. eingeschossiger Satteldachbau im nördlichen Teil mit Frackdach und Fachwerkgiebel mit K-Streben beschrieben. Das Gebäude war vor der Instandsetzung in sehr schlechtem Zustand und einsturzgefährdet. Deshalb wurde der nicht mehr sanierungsfähige Wirtschaftsteil im Süden durch einen Neubau gleicher Kubatur ersetzt. Der älteste Teil stammt aus dem Jahr 1680 (dendro.dat). Allerdings bestätigen Archäologische Grabungen Mauerreste aus dem 12. Jhd. Belegt ist auch die lange Geschichte zunächst einer kommunalen und später privat betriebenen Badestube. Inzwischen ist hier auch das Museum für Archäologie und Gemeindegeschichte eingezogen. Das sanierte Ensemble „Kolb“ wird als Kulturzentrum in Gutenstetten genutzt. Der Backofen im Hofraum wurde wieder errichtet. Eine historische Scheune wurde von Neustadt/A. transloziert und in die Remise eine Schaubrennerei eingebaut. Eine Treppe führt in den Uferbereich der angrenzenden Steinach. Das „Karls Gärtla“ zwischen Scheune und der Steinach wurde nach der Capitulare de villis angelegt.
Au Kolb, Hauptstraße 12 (12, rue principale de Gutenstetten)
En 2006, après la mort de la dernière propriétaire Babette Kolb, cette petite propriété alors inhabitée, comprenait une petite menuiserie ainsi que quelques parcelles de terrain. Cette ferme ne rapportait pas beaucoup, si bien qu’une autre activité s’avérait nécessaire. Les autorités régionales responsables de la restauration des monuments historiques classa ce bâtiment un peu plus tard sous cette rubrique;une maison à un étage avec un toit en pente, queue de pie du côté Nord et un pignon avec colombages muni d’écharpes croisées: critéres indispensables! Il fallut alors remettre cette maison en état, car elle était vraiment délabrée, et était prête à s’écrouler. C’est la raison pour laquelle, la partie côté sud où se trouvait la menuiserie ne fut plus restaurée, on préféra reconstruire le pièce en repectant la même architecture. La partie la plus ancienne remonte à 1680. Cependant, d’après certaines fouilles archéologiques, on a retrouvé des bribes de mur datant du XIIe Siècle. On a aussi pu prouver l’existence d’une salle de bain qui fut d’abord utilisée pendant longtemps par tous les citoyens, ensuite seulement par les propriétaires. Alors maintenant, la commune a aménagé un musée d’archéologie, dans lequel une partie est consacrée à l’histoire du village. Tous ces bâtiments, dès lors restaurés, forment un ensemble servant de centre culturel dans la commune Gutenstetten. Dans la cour, on a édifié de nouveau un four à pain. On a récupéré une grange à Neustadt/A, qu’on a implantée dans cet ensemble et à l’intérieur de lequel on a installé une petite distillerie. Un escalier se trouve sur le bord de la rivière «Steinach» qui coule juste à côté. « Le petit jardin de Charles» situé entre la grange et la rivière a été conçu d’après le plan de” Capitulare de villis”, document officiel ancien mentionnant les préceptes de l’horticulture.
Radlertreff, Hauptstraße 14
Die ehemalige Zehntscheune steht direkt an der Steinach. Das Gebäude war lange Jahre im Besitz des Staates – der Markgrafen von Kulmbach/Bayreuth. Ein exaktes Baudatum konnte nicht ermittelt werden. Viele Zehntscheunen entstanden in der Zeit nach dem Bauerkrieg, also 1525. Ob dies auch hier der Fall war, ist nicht bekannt.1810 vermerkte das Landbauamt Windsheim: gegenwärtiger Zustand mittelmäßig, allerdings noch unentbehrlich. Ein urkundlicher Nachweis stammt aus dem Jahr 1834 als dieses Gebäude vom Staat verkauft wurde. J.S. Höhn bereits Besitzer von zwei weiteren Höfen (Hs-Nr. 13 + 14) erwarb auch dieses Gebäude. In den Grundbuchakten von 1852 ist vermerkt, dass mehrmals größere Geldbeträge -Hypotheken mit der Sicherzeit (Zehntscheune) aufgenommen wurden. 1936 wurde die Zehntscheune an den Darlehnskassenverein verkauft. Sie diente u.a. als Raiffeisenlagerhaus. Das Gebäude wurde immer baufälliger, der Fachwerkgiebel drohte einzustürzen. Glücklicherweise hatten die beiden Ehepaare Frühwald und Knöchlein aus Gutenstetten den Mut die Zehntscheune zu renovieren und nach einigen Jahren eine Gastronomie mit Übernachtungsmöglichkeiten „Das Radlertreff“ zu eröffnen. Für die gelungene Renovierung erhielten Sie im Jahre 1995 den Bayerischen Heimatpreis.
Le relais des cyclistes
Cette ancienne grange , dans laquelle on collectait la dîme, se situe tout près de la rivière «Steinach». Celle-ci appartint longtemps au margrave de Kulmbach/ Bayreuth. On ne put identifier la date de construction . Beaucoup de granges furent construites pendant la révolte des paysans, c’est à dire en 1925. Néenmoins, nous ne savons pas si c’était aussi le cas pour cette grange. Le service d’urbanisme de la ville de Bad Windsheim constata que l’état actuel de cette grange était mediocre, cependant elle était toujours indispensable. Il s’avéra, d’après un document officiel,datant de 1834 que l’Etat dut vendre cette bâtisse. J. S. Höhn déjá propriétaire de deux autres maisons, ( nr. 13 + 14)s’empressa d’acquérir aussi cette grange. Dans les livrets cadastraux, on prend note que l’on pouvait souvent emprunter des sommes plus importantes ou prendre des hypothèques si on était en possession d’ une grange. En 1936 , cette grange fut vendue à la confédération financière. Elle servit entre autre d’entrepôt. Le bâtiment se dégrada de plus en plus, le pignon à colombages était même prêt à s’écrouler. , deux familles ont eu le courage, à Gutenstetten de restaurer cette grange et quelques années plus tard ils l’ont transformée en auberge. Donc en un endroit où l’on peut aller manger et passer la nuit – Ce fut alors le « relais des cyclistes». Cette grange fut restaurée de façon remarquable, ce qui permit aux propriétaires actuels de remporter un prix décerné par l’Etat Bavarois.
Satteldachbau mit Fachwerkgiebel, Steigerwaldstraße 1
Der eingeschossige Satteldachbau des früheren Wohnstallhauses mit aufwendigem Fachwerkgiebel mit Andreaskreuzen, geschweiften Kopfbügel und durchkreuzten Rauten wurde in der 1. Hälfte des 18. Jhd. erbaut und steht unter Denkmalschutz. Das Anwesen liegt im Ortskern und rundet das Fachwerkensemble um die Zehentscheune ab.
Toit incliné avec pignon à colombages; 1, rue de la forêt de Steiger.
Cette maison à un étage et au toit incliné, autrefois une ferme, dotée d’un pignon à colombages de poutres croisées, arquées, et aux pans de bois en losanges fut méticuleusementl édifiée au début du XVIIIéme Siècle et fut désormais classée monument historique. Cette propriété se situe au coeur du village et embellit tout cet ensemble á colombages autour de l’auberge des cyclistes.
Scheune, Steigerwaldstraße
Stattlicher, eingeschossiger denkmalgeschützter Krüppelwalmdachbau mit Hopfengauben und Gitterfachwerk aus der 2. Hälfte des 19. Jhd. Hopfengauben auf den Scheunen sind in den Dörfern nicht mehr oft zu sehen. Viele Scheunen wurden abgebrochen oder umgebaut und die Gauben entfernt. Der Hopfenanbau im Aischgrund ist seit dem 30-jährigen Krieg bekannt. Hier befand sich noch bis zum 19. Jhd. das zeitweise größte Hopfenanbaugebiet Deutschlands. Der Befall der Hopfenpflanzen durch Krankheiten forderte das Spritzen derselben. Die große Abhängigkeit des Ertrags von der Witterung ließ im Volksmund den Spruch reifen:
„Der Hopf ist ein elender Tropf „. Im Zuge der Agrarpolitik des Dritten Reiches wurde 1935/36 die Anbaufläche kontingentiert, sodass sie sehr stark zusammenschmolz. Die Hopfengärten mussten gerodet werden, Hopfenstangen sind seitdem aus der Flur verschwunden.
Grange, rue de la forêt de Steiger
C’est une grange imposante à un étage avec un toit à croupes, muni de lucarnes. Lá on y engrangeait le houblon. Les colombages en forme de grilles, remontent au milieu du XIXéme Siècle. Il est trés rare de voir actuellement dans les villages franconiens des granges de ce type. Soit on détruisait ces granges, soit on les transformaient en supprimant les lucarnes. De pluss on commenca à cultiver le houblon pendant la période de la révolte
des paysans.
Dans les plaines de la Aisch. on peut même prétendre, que se trouvait jusqu’au XIXe Siècle une grande ètendue de champs de houblon. Ce fut d’ailleurs une région la plus connue d’Allemagne pour cette culture.
Les plants de houblon furent alors contaminés, si bien qu’on dû les traiter. La récolte dépendait surtout du temps, c’est ce qu’un proverbe populaire nous illustre : “ le houblon, c’est une sacrée goutte”. Dans les années 1935/1936, sous l’Empire Hitlérien, les surfaces consacrées à la culture de houblon furent très réglementées, ce qui mena á un flagrant regroupement de terres. Les champs de houblon disparurent , et depuis on ne voit même plus de hautes rames à la campagne.
Pfarrhaus, Kirchenweg 2
Der unter Denkmalschutz stehende zweigeschossiger Fachwerkbau mit Satteldach, Joch- und K.-Streben wurde in den Jahren 1689-99 erbaut. Das Pfarrhaus mit dem Pfarrgarten und den Nebengebäuden ist Eigentum der Evang.-Luth. Landeskirche Bayern und Wohnung des jeweiligen Ortspfarrers.
Le presbytère, 2,rue de l’église
Cette demeure à deux étages aux grands pans est aussi classée monument historique. Ces colombages avec une épaisse charpente à chevons fut édifiée entre 1689 et 1699. Ce logis ainsi que le jardin et les bâtiments annexes appartiennent au diocèse bavarois. Les prêtres résident dan ces demeures mis à disposition par l’Etat Bavarois.
Kuhstall - Torpfeiler, Kirchenweg 2
Der ehemalige Kuhstall auf dem Gelände des Pfarrhofes stammt aus dem Jahr 1682 und ist im Ständer-Riegelbau errichtet. Der Torpfeiler stammt aus dem Jahr 1736.
L’étable -pilier, ,rue de l’église
L’ancienne étable se trouve près de la cour du presbytère et remonte à 1682, fut édifiée sur des poteaux. Le pilier fut construit en 1736.
Kapelle St. Martin, Kirchenweg 10
Die Martinskapelle wird heute als Leichenhaus genutzt.
An der Stelle der jetzigen Kirche stand wohl die erste Kapelle St. Martin. Nachdem die jetzige Kirche erbaut und 1500 geweiht wurde entstand in der Nähe der Kapellennachbau, welcher unter Denkmalschutz steht. Eine Martinskapelle ist das Zeugnis einer Besiedlung im 7./8. Jahrhundert.
La chapelle Saint-Martin, 1,rue de l’église
La Chapelle Saint-Martin sert de salle mortuaire.
La chapelle Saint-Martin était là oú se trouve maintenant l’église actuelle. Après que l’église présente ait été érigée et sacrée en 1500, on fit construire á côté la chapelle, qui et classée actuellement monument historique. La chapelle Martin témoigne de la présence d’une civilisation au VIIe au VIIIe Siècle.
Kirche St. Johannes, Kirchenweg 12
Die Kirche wurde ab 1493 (Weihe 1500) im aufgelassenen Friedhof als Saalkirche in Sandsteinquaderbau errichtet. Ein viergeschossiger Turm mit Gurtgesimsen, Walmdach und Polygonalchor mit Strebepfeilern. 1661 wurde dem alten Kirchenschiff ein neues Dach aufgesetzt. Umbau 1883. 1903/05 erhielt die Kirche einen neugotischen Anbau mit zwei Ecktürmen als Aufgang zur Empore. Im Chor ist ein wertvoller Schnitzaltar aus dem Jahr 1511 zu sehen. Die Kirche steht unter Denkmalschutz. Gutenstetten war eine Urpfarrei. Zu dem ursprünglich großen Sprengel gehörten auch die im 15. Jhd. ausgegliederten Pfarreien: Unterlaimbach, Baudenbach, Obersteinbach, Gerhardshofen und Münchsteinach.
L’église Saint-Jean, 12 chemin de l’église
On a commenceé à ériger l’église en 1493 (date du sacre) dans le cimetiére abandonné. Pour cela on utilisa des grosses pierres en grès. Cette église fut munie d’une tour à 4 étages étant entourée de créneaux avec un toit à croupes. Dans cet édifice se trouve un chœur doté de plusieurs angles et de piliers obliques. En 1661 on fit refaire le toit sur l’ancienne nef. En 1883 l’église fut rénovée. De1903 – 1905, l’église fut aggrandie et pourvue de deux tours sur les côtés entre lesquelles se trouve une galerie. Au milieu du chœur en peut admirer un autel méticuleusement sculpté, datant de 1511. Cette église est classée monument historique, ce qui nous prouve que dans la commune de Gutenstetten existe une paroisse trés ancienne. D’autres paroisses comme Unterlaimbach, Baudenbach, Obersteinbach, Gerhardshofen et Münchsteinach étaient aussi rattachées à Gutenstetten puis au XIIe Siècle elles furent independantes.
Kirchhofmauer, Steigerwaldstraße und Kirchenweg
Unregelmäßiges Steinquadermauerwerk, 1436
Le mur du presbytère, rue de la forèt de Steiger, rue de l‘église.
Cette muraille aux grosses pierres apparentes de différentes tailles fut édifiée en 1436.
A l’entrée de cet ensemble se trouve un arc-boutant intégré dans la muraille.
Rehhof, Hauptstraße 22
Das Anwesen wird bereits im Reichssteuerregister von 1497 erwähnt. Aus diesem Jahr wurde auch bei der Umdeckung der dazugehörigen Scheune ein Dachziegel mit dieser Jahreszahl gefunden. Weitere Dachziegelfunde mit den Jahreszahlen 1587+1588. Im 30jährigen Krieg sollen in Gutenstetten bis auf 4 Anwesen alle Gebäude ein Raub der Flammen geworden sein. Dies ist den Chroniken z.B. A. Deiniger zu entnehmen. Die Scheune des Rehhofs soll eines dieser Gebäude sein, das würden auch die Ziegelfunde erklären. Im 17 Jhd. wurde der Rehhof wieder aufgebaut. Die Abgaben wurden an das Kloster Münchsteinach bezahlt. In den darauffolgenden Jahrhunderten wurde der Hof mehrmals verkauft. Johann Hartmann verkaufte den Hof und ging mit seiner Frau und 10 Kindern nach Amerika. 1844 kaufte Friedrich Pfund den Rehhof. Dieser blieb bis 1997 in Familienbesitz. Karl-Heinz Pfund veräußerte diesen und baute ebenfalls in Gutenstetten zusammen mit seiner Frau ein Gästehaus. Der Rehhof wird oft als „Hofgut“ bezeichnet. Woher der Name „Rehhof“ seinen Ursprung hat, ist nicht bekannt.
Au chevreuil, Hauptstraße 22 [22, Rue principale]
Cette maison fut mentionnée d’ailleurs en 1497 dans le registre des impôts de l’Empire. On trouva également cette même date sur une tuile lorsque le toit de la grange fut rénové, On fit aussi la découverte de tuiles sur lesquelles étaient inscrites les dates de 1587 et 1588. Pendant la période de la révolte des paysans, il n’y eu que 4 fermes qui subsistérent aux grands feux. On peut prendre connaissance de ce fait en lisant la chronique de A. Deininger. La grange située á côté de la ferme du chevreuil est un bâtiment qui fut sauvé; les tuiles en témoignent. La maison du chevreuil fût reconstruite au XVIIe Siècle. Les impôts furent versés au monastère de Münchsteinach. Au cours des , cette ferme fut vendue á plusieurs reprises. Johann Hartmann vendit la ferme puis émigra en Amérique avec sa femme et ses 10 enfants. En 1844 Frédéric Pfund acquit la ferme du chevreuil. Celle ci appartenait á ladite famille jusqu’en 1997. Karl-Heinz Pfund s’en sépara et fit construire avec sa femme une maison d’hôtes à Gutenstetten. La ferme du chevreuil s’appelle aussi parfois le petit domaine. L’origine de l’ appelation „maison de che.vreuil“ est méconnue jusqu‘alors.
Hirtenhaus und Schäferei, Hauptstraße 32
Der Besitzer des Anwesens Haus-Nr. 10 + 21 war 1831 Johann Paulus Wehr und Consorten. Es handelte sich um ein Schäfereigut mit Wohnhaus, Kuhstall, Backofen, Schafscheune, Keller, Brunnen, Hofraum und das Hofhaus, welches mit Nr. 20 bezeichnet ist. Die Gutenstettener Schäferei mit einem Muttertierbestand von 1000 bis 1500 Tieren war wohl eine der größten in der Gegend. Das Gebiet reichte bis Baudenbach, sie war ein Münchsteinacher Lehen. Umfangreiche Akten berichten über die streitbaren Schäfer von Gutenstetten, die in der brandenburgischen Zeit bis zu Friedrich dem Großen ging. Die beiden Gebäude der Schäferei stehen heute nicht mehr, geblieben ist nur noch das Hirtenhaus, welches im Besitz der Gemeinde ist. Mit dem letzten Schäfer endete am 19.07.1956 die Schäfertradition in Gutenstetten.
Bergerie, 32, rue principale
Le propriétaire des maisons portant les numéros 10 et 21 s’appelaient Johann Paulus Wehr et Consorten. Il s’egissait d’un domaine ou en élevait des moutons, il y avait aussi un logis, une étable, un fournil, une bergerie, un collier, un puits, une cour et une maison portant le numéro 20. La bergerie de Gutenstetten élevait entre 1000 et 1500 moutons, c’était une des plus grandes bergeries de la région. Les près s’étendaient de Gutenstetten jusqu`á Baudenbach, cela faisait partie du fief de Münchsteinach. Une multitude de documents témoignent de bergers à l’esprit combatif qui furent connus, pendant l‘époque de Brandenburg, par Frédéric le Grand. Les deux bâtiments formant la bergerie ont disparu, il ne reste plus que le logis du berger, dont la commune est propriétaire. Le 19.07.1956 fut le jour oú le dernier berger cessa de faire paître ses moutons. C’est ainsi que disparut cette tradition.
Ehemalige Mühle, Hauptstraße 23
Bereits im 15 Jhd. war der Müller in Gutenstetten im Reichssteuerregister aufgeführt. Die Mühle war dem Kloster Münchsteinach zugehörig. Die wechselhafte Geschichte über Jahrhunderte hinweg prägte auch die Geschichte der Gutenstetter Mühle. 1622 starb die Mutter des Veit vom Berg, geb. Bossack, sie stammte aus der Mühle in Gutenstetten. 1679 verkaufte der Münchsteinacher Klosterverwalter die Mühle an den Neustädter Hammerschmied Georg Scheuenstuhl. Weitere Besitzer folgten bis 1772 Tobias Friedrich Deininger einheiratete. Diese Familie blieb fünf Generationen auf der Mühle. Andreas Deininger war nicht nur Mühlenbesitzer sondern auch Bürgermeister und Landtagsabgeordnete sowie Heimatschriftsteller. Durch den frühen Tod von J. W. Deininger im 2. Weltkrieg endetete die Geschichte der Müllerfamilie Deininger in Gutenstetten. Im Rahmen eines Stilllegungsprogrammes der Bundesregierung beendete die Müllerei in Gutenstetten dauerhaft. Die Mühle befindet sich in Privatbesitz.
L’ancien moulin, Hauptstraße 23
Le meunier de Gutenstetten était d’ailleurs cité dans le registe officiel de la dîme. Le moulin appartenait au monastière de Münchsteinach. Cette période mouvementée durant des siècles, eut également une influence sur le meunier de Gutenstetten. La mère de Veit vom Berg, née Bossack mourut en 1622. Elle était originaire du moulin de Gutenstetten. L’intendant du monastère de Münchsteinach vendit le moulin à Georg , forgeron de Neustadt. Il y eut d’autres propriétaires, entre autre Tobias Friedrich Deininger qui se maria en 1772. Cette famille reste pendant cinq générations au moulin. Andreas Deininger n’était pas seulement meunier mais aussi maire et député du gouvernement bavarois ainsi qu’écrivain local. J. W. Deininger mourut jeune durant la seconde guerre mondiale, ce qui entraina la disparition de cette famille de meunier à Gutenstetten. Le gouvernement allemand ordonna par décret de clore les moulins. Le moulin actuellement appartient à une famille.
Prießenhaus, Gartenstraße 8
Zweigeschossiger Schopfwalmdachbau mit Fachwerkobergeschoss, erdgeschossig profilierte, geohrte Rahmungen und genutete Ecklisenen. Für die damalige Zeit hatte das Haus hohe Räume. Laut Liquidationsbuch von 1834 wurde das Haus 1823 neu erbaut. 1927 wurde das Haus renoviert, als Oberlehrer Prieß aus Gräfenberg in den Ruhestand versetzt wurde, daher auch der Hausname. Das Haus wurde von den heutigen Besitzern Hedwig + Helmut Reiß 1978/79 aufwendig innen restauriert. Das verputzte Fachwerk wurde 1985/86 wieder freigelegt.
La maison de la famille Prieß, 8 Rue du jardin
C’est une maison à deux étages, avec un toit muni d‘un pignon avec une petite croupe. Au 1e et 2e étage on peut voir des colombages. Au rez-de- chaussé, un cadre en ciment épais met les fenêtre en reliefs, les angles ont des rainures. D’après le cadastre., la maison fut reconstruite en 1823. En , elle fut renovée, lorsque Mr. Prieß alors professeur, natif de Gräfenberg fut à la retraite. La maison porte encore son nom. Les propriétaires actuels, Hedwig et Helmut Reiß renovérent entiérement cette magnifique demeure. En 1985 – 1986, on enleva le crêpis pour mettre en evidence les colombages.
Keimzelle Gutenstetten, Blumenstraße 12
Aus dem Erdaushub des Anwesens Friedrich hier in der Blumenstraße 12, einst Haus-Nr.: 3 + 4 wird im Jahr 2000 der erste sichere Nachweis einer dauerhaften Siedlung aus der Latènezeit (500 – 100 vor Chr.) erbracht.
„Somit können wir auch ohne schriftliche Urkunden den ersten sicheren Nachweis der Existenz von Gutenstetten erbringen.“ (Laut Denkmalamt Nürnberg ist die Nachweiskette vorhanden). Siehe Station 3 im Museum.
L’origine de Gutenstetten, 12,rue des fleurs
C’est sur le terrain de la famille Fréderic, ici 12 Rue des fleurs, que s’est installée une colonie pour longtemps. En l’an 2000, alors on a pu prouvé que, les maisons aux numéros 3 et 4, étaient l’endroit oú cette population s’était établie (500 – 100 ans avant J.C.).
Nous n’avons aucune preuve écrite. Cependant, cette ferme témoigne de l’existence de Gutenstetten et en est l’origine D’aprés le service des documents historiques á Nuremberg,il y a d’ailleurs une plaquette prouvant tout cela,(voir station 3 au musée)
Gasthaus Rotes Roß, Blumenstraße 8
1655 wurde der Maurer Pancratius Plenckhart als Wirt im „vordere Wirtshaus“ erwähnt. Im 18. Jahrhundert wird der damalige Gastwirt als Wirt und Weinschenk bezeichnet. Es ist nicht auszuschließen, dass damals Wein aus Gutenstetten ausgeschenkt wurde. Es ist nachgewiesen, dass hier viele Jahrhunderte Wein angebaut wurde. In den Archivalien ist oft von Häckersgütlein die Rede. Ab 1709 wird der Wirt zusätzlich auch als Metzger bezeichnet. Die Entstehung des stattlichen Gebäudes mit der rundbogigen Aufzugsluke im Giebel und schönen Holzdecken im Inneren dürfte auf das Jahr 1702 zurückgehen. Es wurde auch über viele Jahre hinweg im Gasthaus Bier gebraut, zumindest wurden viele Besitzer als Bierbrauer bezeichnet. 1739 heiratete Georg Deininger, ein Bäcker in die Gastwirtsfamilie ein. Als er 1762 starb wurde er als Gastwirt, Büttner, Bierbrauer sowie auch Zolleinnehmer in Gutenstetten bezeichnet. Aufgrund der weiblichen Nachkommen geht der Besitz auf die Familie Gärtner, damals Markt Lenkersheim über. 1811 wird Johann Andreas Ficht als Gastgeber „Zum roten Roß“ erwähnt. 1850 wird Johann Kolb aus Emskirchen als neuer angehender Gastwirt und Bierbrauer auf Hausnummer 8 eingetragen. 1869 erscheint der Bauernsohn Johann Loesch als Gastwirt. 1872 folgte Johann Michael Goetz. Es folgte Christof Mader als Gastwirt. Der vorletzte Wird „Zum roten Roß“ war Johann Ludwig Pfeiffer. Dessen Sohn Johann Martin Pfeiffer beschloss als letzter Wirt die mindestens 350 Jahre zurückreichende Tradition des Gasthauses „Zum roten Roß“.
L’auberge du » cheval rouge », Blumenstraße 8 (8,rue des fleurs)
C’est en 1655 que fut évoqué Pancratius Plenkhart alors macon. A cette époque lá, il fut le patron de l’auberge située á l’entrée du village. Au XVIII éme siécle, ledit patron était aubergiste et vendait du vin. On prétend même que le vin consommé provenait de Gutenstetten. En effet, on y cultiva des vignes pendant des siécles. Dans les archives, on évoque souvent le patron de l’auberge du terroir oú on y vend son propre vin.
En 1709, le patron est alors boucher. Cette maison imposante avec pignon dans lequel se trouve une lucarne,munie d’un arc en plein ceintre, remonte á 1702. On pouvait même utiliser un élévateur pour approvisionner la salle á manger. Nous vous invitons aussi á admirer á l’intérieur les plafonds en bois. Dans cette auberge, on y brassa pendant longtemps de la biére. Il s’avére aussi que de nombreux brasseurs s’y sont succédés. Georg Deininger, épousa en 1739 la fille du patron. Celui-ci mourut en 1762.On nous relate également qu’il avait exercé divers métiers : patron de l’auberge,tonnelier,brasseur… Il était même responsable des droits de douane. Comme ils n’eurent que des filles, c’est la famille Gärtner, originaire,autrefois de Lenkersheim, qui hérita de cette affaire. En 1811, Johann Andreas Ficht s’avére être la patron du « Cheval Rouge ». En 1850, c’est Jean Kolb de Emskirchen qui prend la suite et sera en conséquence le patron et le brasseur. A cette auberge fût attribué le numéro 8. En 1869, le fils de Jean Loesch, alors fermier, devint le patron. En 1872, ce fut Jean-Michel Goetz qui pris la succession. Puis plus tard Christof Mader. L’avant-dernier patron du « Cheval rouge » fût Jean-Louis Pfeiffer.Le fils de celui-ci, Jean Martin Pfeiffer, ferma l’auberge du « cheval rouge »après 350 ans de tradition.
Früheres Amtshaus, Blumenstraße 4
An dieser Stelle steht innerhalb der letzten 100 Jahre das dritte Haus. 1912 wurde das einstige Gerichtsgebäude das um 1500 errichtet worden war und auch ein Gefängnis hatte, abgebrochen. Das folgende Gebäude hatte nur knapp 100 Jahre Bestand. Inzwischen wurde auf diesem Grundstück ein Neubau errichtet. Mit Übergang des Fürstentums Kulmbach/Bayreuth 1792 an die Hohenzollern, also den brandenburgischen Staat ging auch die Gerichtsbarkeit an die Stadtvogteiämter über. Die Rechtsprechung erfolge dann nicht mehr vor Ort, somit wurde das Gebäude in dieser Form auch nicht mehr genutzt. 1833 ist auf dieser Hofstelle eingetragen: Wohnhaus mit Scheune, angebauter Stallung, Schweinestall, Hofraum, Schorr-, Gras und Hopfengarten. Die Sitten der Haft waren damals anders: Die Angehörigen oder das Vermögen des Verurteilten musste aufgebracht werden um die Gefängniskosten zu begleichen. So kam es häufig zu Todesstrafen oder wie in einem Fall aus Ullstadt Ende des 18. Jdh. als eine zu 6 Jahren verurteilte Kindsmörderin nach 3 Jahren begnadigt wurde, weil die Prozeß- und Zuchthauskosten den Erlös des vorhandenen Vermögens um ein Vielfaches überschritten.
L’ancienne salle d‘ audience, Blumenstraße 4 ( 4,rue des fleurs)
Au cours du dernier siécle se succédérent trois maisons á cet endroit. L’ancienne salle d’,audience,édifiée vers 1500 incluant aussi une prison, fût démolie en 1912. Plus tard, on fit construire une maison qui subsista une centaine d’années. A la suite de cela, une bâtiment fût édifiée donc á la même place. La principauté de Kulmbach/ Bayreuth revint en 1792 á la Dynastie des Hohenzollern, plus précisément á la région de Brandenburg si bien que la magistrature passa au bailli de la la ville respectueuse. Le pouvoir judiciaire ne fût plus exercé sur place si bien que ce bâtiment n’avait aucune utilité. Cet édifice fût mentionné en 1833 dans le registre publique. Tout cet ensemble incluait une grange, une étable,une porcherie, une cour, un lopin de terre, un couderc et un jardin á houblon. Une condamnation était autrefois soumise á d’autres principes.Il fallait rassembler les parents ainsi que le bien du condamné afin de pouvoir régler les frais d’arrestation. Les détenus furent souvent condamné soit á la peine de mort ou furent acquittés. Ce fût le cas á Ullstadt á la fin du XVIIIéme siécle lorsque une femme commis un meurtre auprés d’un enfant. Cette femme meurtriére, condamnée á 6 ans d’arrestation, fût graciée après trois de peine puisque les coûts du procés et de l’établissement pénitencier eurent bien dépassés la somme collectée.